
25. Inneres gegen Chor nach 1957

 Sie beauftragte Architekt Karl Müller aus Zürich-Höngg mit der Ausarbeitung von Plänen, die am 7. Dez. 1937 in zwei Varianten vorlagen. Die erste sah eine sanfte Renovation mit nur geringfügigen Veränderungen vor, nämlich Einbau einer elektrischen Heizung und einer neuen Bestuhlung, einen frischen Anstrich und Ausbesserung des Bodens. Mit der zweiten Variante schlug Müller hingegen eine totale Umgestaltung des Innenraums vor, indem nebst neuer Heizung und Bestuhlung auch eine neue Empore entstehen sollte und der Chor durch Umzug der Orgel auf die Empore freigelegt werden sollte. Damit könnte unsere Kirche (...) nach diesen Projekten im archidektonischen und heimeligen Stil wieder neu erstehen.
Sie beauftragte Architekt Karl Müller aus Zürich-Höngg mit der Ausarbeitung von Plänen, die am 7. Dez. 1937 in zwei Varianten vorlagen. Die erste sah eine sanfte Renovation mit nur geringfügigen Veränderungen vor, nämlich Einbau einer elektrischen Heizung und einer neuen Bestuhlung, einen frischen Anstrich und Ausbesserung des Bodens. Mit der zweiten Variante schlug Müller hingegen eine totale Umgestaltung des Innenraums vor, indem nebst neuer Heizung und Bestuhlung auch eine neue Empore entstehen sollte und der Chor durch Umzug der Orgel auf die Empore freigelegt werden sollte. Damit könnte unsere Kirche (...) nach diesen Projekten im archidektonischen und heimeligen Stil wieder neu erstehen. Gemeint war eine Rückbesinnung auf das Kircheninnere des 17. Jahrhunderts und eine Ausstattung mit viel Holz im Sinne des Heimatstils, der in der Schweiz vor und während dem zweiten Weltkrieg weit verbreitet war und sich auf das nationalistische und rustikale Erbe berief.
Gemeint war eine Rückbesinnung auf das Kircheninnere des 17. Jahrhunderts und eine Ausstattung mit viel Holz im Sinne des Heimatstils, der in der Schweiz vor und während dem zweiten Weltkrieg weit verbreitet war und sich auf das nationalistische und rustikale Erbe berief. Durch den Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurde die weitere Planung jedoch zurückgestellt. Die Kirche wurde gemäss Protokoll vom 14. Dezember 1939 zeitweise für den gewöhnlichen Schulunterricht benötigt, da zwei Kompanien Grenzbesetzungssoldaten im Schulhaus einquartiert wurden, das allerdings nicht zur Freude der Kirchenpflege, die wegen der Vollheizung Schäden an der Orgel befürchtete.
Durch den Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurde die weitere Planung jedoch zurückgestellt. Die Kirche wurde gemäss Protokoll vom 14. Dezember 1939 zeitweise für den gewöhnlichen Schulunterricht benötigt, da zwei Kompanien Grenzbesetzungssoldaten im Schulhaus einquartiert wurden, das allerdings nicht zur Freude der Kirchenpflege, die wegen der Vollheizung Schäden an der Orgel befürchtete. 1941 wurde aus energetischen Gründen ein Windfang beim Hauptportal und eine Wintertüre auf der Südseite angebracht.
1941 wurde aus energetischen Gründen ein Windfang beim Hauptportal und eine Wintertüre auf der Südseite angebracht.


 , und den neuen Bänken erhielt die Kirche eine neue, wieder tieferliegende, von zwei Holzpfeilern gestützte Empore mit gerader Brüstung. Tiefer gelegt wurde auch die neue Kanzel anstelle der alten mit dem engen, steil gewendelten Treppenaufstieg, wohl wie die übrigen Ausstattungsstücke ein Entwurf von Architekt Müller. Die alte Chororgel wurde abgebrochen und ersetzt durch ein vollständig neues, grösseres Instrument von Ziegler und Co, Uetikon, das in der nordwestlichen Ecke der Empore angebracht wurde. Der nach Entfernung der Orgel wieder einsichtige Chorraum erhielt ein Brusttäfer, der Boden im ganzen Kirchenraum wurde mit Klinkerplatten belegt. Im Westen des Langhauses wurde ein Windfang über die ganze Kirchenbreite eingezogen, somit der Aufgang auf die Empore durch eine Wand vom Kirchenraum getrennt wurde und überdies ein kleines Räumchen für den Pfarrer entstand. Alle Dekorationsmalereien wurden weiss übermalt. Der Turm erhielt auf seiner Nordseite eine neue Aussentreppe mit Zugang ins erste Geschoss; im Erdgeschoss wurde die neue Abortanlage eingebaut. Am 25. Oktober 1946 waren die Arbeiten vergeben worden und im November wurde die alte Ausstattung für rund Fr. 700.- vergantet.
, und den neuen Bänken erhielt die Kirche eine neue, wieder tieferliegende, von zwei Holzpfeilern gestützte Empore mit gerader Brüstung. Tiefer gelegt wurde auch die neue Kanzel anstelle der alten mit dem engen, steil gewendelten Treppenaufstieg, wohl wie die übrigen Ausstattungsstücke ein Entwurf von Architekt Müller. Die alte Chororgel wurde abgebrochen und ersetzt durch ein vollständig neues, grösseres Instrument von Ziegler und Co, Uetikon, das in der nordwestlichen Ecke der Empore angebracht wurde. Der nach Entfernung der Orgel wieder einsichtige Chorraum erhielt ein Brusttäfer, der Boden im ganzen Kirchenraum wurde mit Klinkerplatten belegt. Im Westen des Langhauses wurde ein Windfang über die ganze Kirchenbreite eingezogen, somit der Aufgang auf die Empore durch eine Wand vom Kirchenraum getrennt wurde und überdies ein kleines Räumchen für den Pfarrer entstand. Alle Dekorationsmalereien wurden weiss übermalt. Der Turm erhielt auf seiner Nordseite eine neue Aussentreppe mit Zugang ins erste Geschoss; im Erdgeschoss wurde die neue Abortanlage eingebaut. Am 25. Oktober 1946 waren die Arbeiten vergeben worden und im November wurde die alte Ausstattung für rund Fr. 700.- vergantet.


 und am 10. Oktober des gleichen Jahres, wohl zum Abschluss der Renovation, entstand die heutige, über die ganze Breite der Chorwand gemalte Inschrift.
und am 10. Oktober des gleichen Jahres, wohl zum Abschluss der Renovation, entstand die heutige, über die ganze Breite der Chorwand gemalte Inschrift.
 Als letztes bewegliches altes Ausstattungsstück wurde der Taufstein aus der Kirche auf den Friedhof verbannt.
Als letztes bewegliches altes Ausstattungsstück wurde der Taufstein aus der Kirche auf den Friedhof verbannt. 
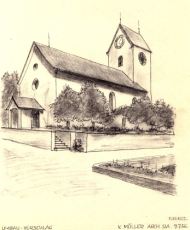


 Am 30.des gleichen Monats wurde mit der Glockengiesserei Rütschi in Aarau der Vertrag für das neue Geläut und die Geläutekombination abgeschlossen.
Am 30.des gleichen Monats wurde mit der Glockengiesserei Rütschi in Aarau der Vertrag für das neue Geläut und die Geläutekombination abgeschlossen. Im April standen die gewünschten Glockeninschriften fest.
Im April standen die gewünschten Glockeninschriften fest. Der Glockenguss erfolgte am 23.Mai und am 24. August fand nach einem grossen Glockentransfer-Umzug am Vortag der feierliche Glockenaufzug statt; für den Glockenempfang und die hungrigen Begleiter wurden 45O Stück Spez.Schübling in zwei Metzgereien bestellt.
Der Glockenguss erfolgte am 23.Mai und am 24. August fand nach einem grossen Glockentransfer-Umzug am Vortag der feierliche Glockenaufzug statt; für den Glockenempfang und die hungrigen Begleiter wurden 45O Stück Spez.Schübling in zwei Metzgereien bestellt.
 An den Schallfenstern erhitzten sich die Gemüter, denn der Gemeinderat wollte die rechteckige Ausführung nicht akzeptieren und involvierte den Heimatschutz. Schliesslich fand man den heutigen Kompromiss eines rechteckigen Fensters mit einem Mittelgewände.
An den Schallfenstern erhitzten sich die Gemüter, denn der Gemeinderat wollte die rechteckige Ausführung nicht akzeptieren und involvierte den Heimatschutz. Schliesslich fand man den heutigen Kompromiss eines rechteckigen Fensters mit einem Mittelgewände. Der Verputz der Turmwestseite sollte komplett abgeschlagen und neugemacht werden.
Der Verputz der Turmwestseite sollte komplett abgeschlagen und neugemacht werden. Bei der Gelegenheit wollte man auch die Turmuhr von der Uhrenfirma Mäder AG in Andelfingen umbauen lassen; das Zifferblatt sollte weniger wetteranfällig sein und daher aus einer ganzen Kupferscheibe und nicht nur aus einem Kranz bestehen. Mäder empfahl die Verwendung des günstigeren und billigeren Leichtmetalls Antikorodal. Die Uhr bekam damit ihr heutiges Aussehen mit einem Zifferblattkern in Züri-Blau, vergoldeten römischen Zahlen auf schwarzem Grund und vergoldeten Zeigern.
Bei der Gelegenheit wollte man auch die Turmuhr von der Uhrenfirma Mäder AG in Andelfingen umbauen lassen; das Zifferblatt sollte weniger wetteranfällig sein und daher aus einer ganzen Kupferscheibe und nicht nur aus einem Kranz bestehen. Mäder empfahl die Verwendung des günstigeren und billigeren Leichtmetalls Antikorodal. Die Uhr bekam damit ihr heutiges Aussehen mit einem Zifferblattkern in Züri-Blau, vergoldeten römischen Zahlen auf schwarzem Grund und vergoldeten Zeigern. Die Turmkrone wurde vom Otelfinger Schlosser Josef Schwitter nach dem alten Muster aus verzinktem Eisen in zwei Teilen hergestellt und von Mäder in Andelfingen vergoldet.
Die Turmkrone wurde vom Otelfinger Schlosser Josef Schwitter nach dem alten Muster aus verzinktem Eisen in zwei Teilen hergestellt und von Mäder in Andelfingen vergoldet.

 Am 16. Juli 1957 wurden die Umgebungsarbeiten dem Gartenbau-Architekten Ammann in Zürich vergeben.
Am 16. Juli 1957 wurden die Umgebungsarbeiten dem Gartenbau-Architekten Ammann in Zürich vergeben. Nach seinem Vorschlag vom 16. September wurden die vier Pfeiler der Vorhalle nicht in Eichenholz, sondern in Würenloser Stein gefertigt; aus dem Würenloser Steinbruch stammt auch der Mosaikplattenbelag für den Vorbau. Die gewünschte rustikale Wirkung wurde auch so erreicht.
Nach seinem Vorschlag vom 16. September wurden die vier Pfeiler der Vorhalle nicht in Eichenholz, sondern in Würenloser Stein gefertigt; aus dem Würenloser Steinbruch stammt auch der Mosaikplattenbelag für den Vorbau. Die gewünschte rustikale Wirkung wurde auch so erreicht. Im rustikalen Heimatstil entwarf Ammann auch die Umfassungsmauer und die Treppen, die von Othmar Meier in Regensdorf ausgeführt wurden. Die Bauabrechnug wurde am 1. Dezember 1958 vorgelegt.
Im rustikalen Heimatstil entwarf Ammann auch die Umfassungsmauer und die Treppen, die von Othmar Meier in Regensdorf ausgeführt wurden. Die Bauabrechnug wurde am 1. Dezember 1958 vorgelegt.
 Bei einigen der bemalten Glasfenster von 1902 war durch die Hitze das Blei geschmolzen, so dass sie verloren waren.
Bei einigen der bemalten Glasfenster von 1902 war durch die Hitze das Blei geschmolzen, so dass sie verloren waren. Durch Rauch, Russ und Löschwasser wurde der gesamte Innenraum und auch die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Bereits am 3. Dezember 1968 stand fest, dass die Kirche vor allem mit der schönen Holzdecke wiederhergestellt werden sollte. Mit der Durchführung der Renovationsarbeiten wurde Architekt Gustav Kellenberger, Zürich, betraut.
Durch Rauch, Russ und Löschwasser wurde der gesamte Innenraum und auch die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Bereits am 3. Dezember 1968 stand fest, dass die Kirche vor allem mit der schönen Holzdecke wiederhergestellt werden sollte. Mit der Durchführung der Renovationsarbeiten wurde Architekt Gustav Kellenberger, Zürich, betraut.
 Da sie 52 Pfeiffen mehr hatte und entsprechend mehr Platz benötigte als die verbrannte Vorgängerin, war sich die Kirchenpflege einig, sie nun in der Mitte der Empore zu platzieren; für das Gehäuse wählte man Eichenholz. Die Empore wurde neu als Sängerempore organisiert mit einer seitlichen Reihe von Bänken und im übrigen einer lbeweglichen Bestuhlung.
Da sie 52 Pfeiffen mehr hatte und entsprechend mehr Platz benötigte als die verbrannte Vorgängerin, war sich die Kirchenpflege einig, sie nun in der Mitte der Empore zu platzieren; für das Gehäuse wählte man Eichenholz. Die Empore wurde neu als Sängerempore organisiert mit einer seitlichen Reihe von Bänken und im übrigen einer lbeweglichen Bestuhlung.
 So wurde die kritisierte Möblierung bis heute beibehalten. Die Eröffnungsfeier der wiederhergestellten Kirche fand am 1. Februar 1970 statt.
So wurde die kritisierte Möblierung bis heute beibehalten. Die Eröffnungsfeier der wiederhergestellten Kirche fand am 1. Februar 1970 statt. Mit Ausnahme der nun zentrierten neuen Emporenorgel und den neutralen Fensterscheiben blieb das durch die Um- und Einbauten von 1946/47 und 1957 geprägte Aussehen der Kirche bis heute weitgehend unverändert.
Mit Ausnahme der nun zentrierten neuen Emporenorgel und den neutralen Fensterscheiben blieb das durch die Um- und Einbauten von 1946/47 und 1957 geprägte Aussehen der Kirche bis heute weitgehend unverändert.
 Mit Ausnahme des 1957 für das Chorfenster von Robert Brunner geschaffenen Glasgemäldes, das von seiner starken Verrussung gereinigt werden konnte, sind seither die Kirchenfenster so leicht getönt, dass dies kaum bemerkt wird.
Mit Ausnahme des 1957 für das Chorfenster von Robert Brunner geschaffenen Glasgemäldes, das von seiner starken Verrussung gereinigt werden konnte, sind seither die Kirchenfenster so leicht getönt, dass dies kaum bemerkt wird.